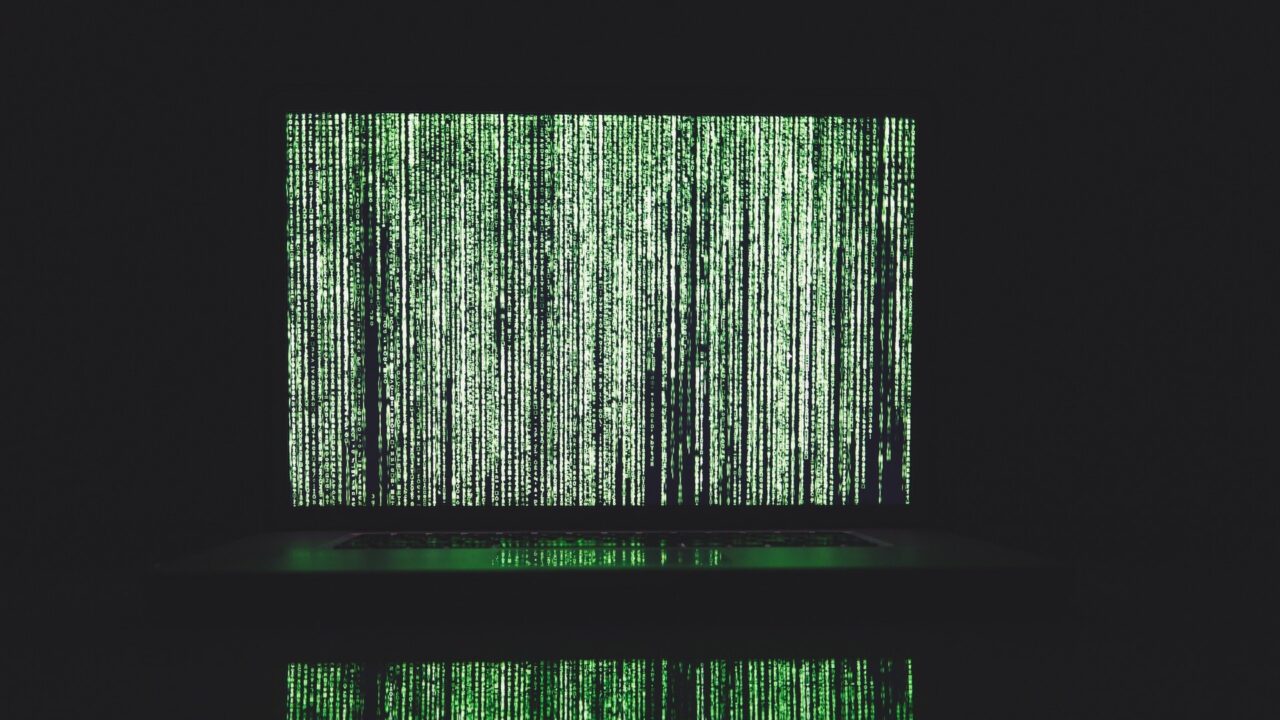In den letzten Tagen haben sich eine Menge Leute darüber entrüstet, dass der kostenlose Dienst Unroll.me Nutzerdaten an Uber verkauft hat. Zeit, mal wieder darüber nachzudenken, dass kostenlos eben nicht umsonst bedeutet.
Nutzer von Unroll.me sind entrüstet – aber warum?
Was war los? Vor ein paar Tagen berichtete die New York Times, dass der kostenlose Dienst Unroll.me Nutzerdaten (allerdings ohne Namensnennung) an Uber verkauft hat.
Unroll.me ist ein kostenloser Service, der verspricht, das Email-Konto eines Nutzers aufzuräumen. Alle Junk-Mails und Newsletter sollen übersichtlich aufgelistet werden. So soll man in der Lage sein, schnell zu entscheiden, welche Newsletter nur das Postfach verstopfen und doch nicht gelesen werden. Auch das Abbestellen unerwünschter Newsletter soll durch den Dienst vereinfacht werden. Unroll.me selbst nennt sich den „einfachsten Weg, die Inbox zu managen“.
Dazu braucht man natürlich Zugang zu den E-Mails der Nutzer. Der Dienst verspricht aber: wir werden deinen persönlichen Kram niemals anrühren (… we’ll never touch your personal stuff).
Durch den Bericht der New York Times stellte sich jetzt heraus, dass Unroll.me eben doch Daten verkauft. Die Mutterfirma des Unternehmens, Slice Intelligence, sammelte zum Beispiel Quittungen des Uber-Konkurrenten Lyft aus den Postfächern der Unroll-Me-Nutzer und verkaufte die Daten anonymisiert an Uber.
Unroll.me-Nutzer sind nun empört, dass der Dienst ihre Daten weitergibt. Und der CEO von Unroll.me? Ist untröstlich darüber, dass sich einige Nutzer aufregen, als sie herausfinden, wie der kostenlose Service sich finanziert.
„So it was heartbreaking to see that some of our users were upset to learn about how we monetize our free service“.
Schließlich müsste man doch nur einen Blick in die Datenschutzrichtlinie werfen. Dort steht klar: Wir dürfen unpersönliche Daten zu jedem Zweck sammeln, nutzen, übermitteln, verkaufen und weitergeben. („We may collect, use, transfer, sell, and disclose non-personal information for any purpose.“)
If you’re not paying for it, you are the product
Eigentlich logisch: die wenigsten Anbieter entwickeln ihre nützlichen Dienste aus reiner Menschenfreundlichkeit. Ressourcen, Menschen, Arbeitszeit – das alles muss irgendwie bezahlt werden. Kostenlose Dienste fungieren entweder als Werbung für weitere, bezahlte Inhalte (Freemium-Modell) oder sie finanzieren sich über andere Wege, durch den Verkauf von Anzeigen oder Nutzerdaten.
Die meisten Nutzer vergessen dies allerdings. Ich muss gestehen, dass ich auch einen Augenblick überlegt habe, Unroll.me zu nutzen, als ich das erste Mal davon gehört habe. Allerdings war mir bei dem Gedanken, einem kostenlosen Dienst Zugriff auf meine Mails zu geben, nicht wohl. Glücklicherweise habe ich mich dagegen entschieden. Überhaupt ist es eine gute Idee, möglichst wenig Diensten Zugang zu seinem Google-Konto zu gewähren. Und wenn man es getan hat und sie irgendwann nicht mehr nutzt, sollte man sie wieder löschen. Zur Überprüfung loggt man sich einfach ab und zu mal an der entsprechenden Stelle bei Google ein.
Vor dem Anmelden nachdenken und auf sein Gefühl hören
Seit einigen Jahren meide ich z.B. Apps, die sich über eingeblendete Werbung finanzieren. Lieber zahle ich ein paar Euro dafür, um die Entwicklung zu finanzieren. Das garantiert nicht unbedingt, dass man nicht doch noch auf andere Art Geld mit mir als Nutzer macht, senkt aber doch das Risiko in meinen Augen erheblich.
Nach Alternativen Ausschau halten
Aus diesem Grund kann ich es auch nachvollziehen, wenn Kollege Jürgen Vielmeier auf der Jagd nach Google-Alternativen ist. Schließlich verdient das Unternehmen sein Geld mit Werbung. Mit möglichst individueller Werbung, die auf dem Wissen über die Vorlieben der Nutzer aufbaut. Wie man an seinen Berichten sieht, ist es aber gar nicht so einfach, den Angeboten Googles zu entkommen. Welche Alternative gibt es schon zu Google Maps?
Ich vertraue momentan auf Apple Maps. Immerhin verdient das Unternehmen sein Geld mit dem Verkauf von Hardware, da hoffe ich darauf, dass die Datensammellust nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei Google. Oder dass man die Daten zumindest nicht benutzt, um Geld mit Werbung zu verdienen.
Auch Navigationssoftware, die auf Open Street Maps aufbaut, habe ich schon verwendet. Leider scheint mir Google Maps immer noch am ausgereiftesten zu sein. Aber Apple hat mit seinen Karten nach dem wenig überzeugenden Einstieg 2012 ordentlich aufgeholt. Auch die Integration in iOS und macOS ist verständlicherweise nahtloser als im Fall von Google Maps.
Das alte Dilemma: Sicherheit gegen Bequemlichkeit
Absoluten Schutz davor, dass Unternehmen Nutzerdaten ohne deren Wissen und Wunsch verwenden, gibt es leider nicht. Aber man kann das Risiko minimieren. Bevor man einen kostenlosen Dienst nutzt, sollte man sich immer überlegen, ob man ihn wirklich braucht und wie vertrauenswürdig er ist. Warum wird er zur Verfügung gestellt? Wie finanziert er sich? Wenn man etwas daran merkwürdig findet, sollte man vielleicht auf den vermeintlichen Komfort des Dienstes verzichten.
Unerwünschte Newsletter kann man auch per Hand abbestellen. Das mag etwas umständlicher sein, aber man bleibt Herr über seine Daten – so weit das heutzutage möglich ist.
Bilder: pexels.com
Jetzt kommentieren!